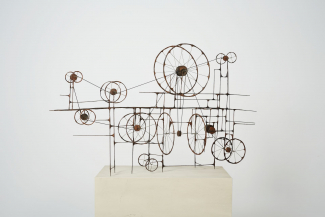Eine ganze Epoche mit einem einzelnen Begriff zu prägen, gelingt nur äußerst selten. Dem jungen Mannheimer Kunsthallen-Direktor Gustav F. Hartlaub ist mit seiner legendären Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ 1925 jedoch genau das geglückt. Weit über seine kunsthistorische Bedeutung hinaus, ist der Begriff zum Synonym für den kulturellen Aufbruch der 1920er-Jahre geworden – und für die in Kunst, Architektur und Literatur zu beobachtende Rationalität und sachliche Präzision, die als Reaktion auf die großen politischen und sozialen Umwälzungen dieses Jahrzehnts gelten kann. Hundert Jahre später widmet die Kunsthalle Mannheim dem Phänomen „Neue Sachlichkeit“ eine große Ausstellung, die sowohl die damalige Leistung würdigt, sie aber auch kritisch hinterfragt und ergänzt, vor allem um das Schaffen von Künstlerinnen, war doch in der Ausstellung von 1925 keine einzige Frau vertreten.
Kuratorin: Dr. Inge Herold
kuratorische Assistenz: Dr. Manuela Husemann und Dr. Gunnar Saecker
Die Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Gefördert durch:

Medienpartner:

Die 1920er-Jahre und die Neue Sachlichkeit
Die 1920er-Jahre waren von einer politischen und gesellschaftlichen Zeitenwende nach dem Ende des Ersten Weltkriegs geprägt. Vor allem in den frühen 1920er-Jahren formten Armut und Arbeitslosigkeit die Gesellschaft. Ab 1923 erlebte die Weimarer Republik einen starken wirtschaftlichen Aufschwung, der 1929 mit dem Börsencrash ein Ende fand.
Die bedeutende Kunstströmung des Jahrzehnts war die Neue Sachlichkeit. Wichtige Themen waren die sozialen Missstände, aber auch die politische und gesellschaftliche Situation des Landes im Umbruch. Die Abbildung der nüchternen Wirklichkeit stand dabei im Vordergrund. Künstler wie George Grosz, Otto Dix, Max Beckmann, Christian Schad u.v.m. waren führende Vertreter.
Die Neue Sachlichkeit etablierte sich nicht nur in Deutschland. Auch in Österreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden und weiteren Ländern fanden namhafte Künstler*innen zu diesem Stil. Mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise verlor der neusachliche Malstil zunehmend an Kraft.
Die Ausstellung 1925
Der Direktor der Mannheimer Kunsthalle Gustav F. Hartlaub präsentierte in der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ etwa 32 Künstler mit rund 130 Gemälden unter anderem von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Heinrich Maria Davringhausen, Adolf Erbslöh, Ernst Fritsch, Nicolas Gluschenko, Ernst Haider, Wilhelm Heise, Karl Hubbuch, Alexander Kanoldt, Walter Schulz-Matan, Carlo Mense, Anton Räderscheidt, Rudolf Schlichter, Georg Schrimpf, Georg Scholz und Niklaus Stoecklin.
Mit der Ausstellung charakterisierte Hartlaub die aktuelle, am Gegenstand orientierte Bewegung der deutschen Nachkriegskunst „seit dem Expressionismus“, wie der Untertitel lautete. Nach seiner bereits 1922 entwickelten Definition, der 1923 die Findung des Begriffs folgte, unterschied er zwei Flügel: eine konservative, an Renaissance, Klassizismus und den Nazarenern orientierte Malerei und eine veristisch-sozialkritische Richtung, als deren Hauptvertreter George Grosz und Otto Dix gelten.
Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum
Mit dem Ausstellungsprojekt „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ blickt die Kunsthalle Mannheim auf die unzweifelhaft bekannteste wie auch bedeutendste Ausstellung in ihrer über 100-jährigen Geschichte zurück. Die große Jubiläumsausstellung gliedert sich in verschiedene Themenbereiche, bei denen das damalige Ausstellungskonzept hinterfragt und auch kritisch ergänzt wird. Gleichzeitig wird das politische Klima des aufkommenden Nationalsozialismus thematisiert.
In der Ausstellung werden circa 200 Arbeiten von annähernd 100 Künstler*innen von nationalen und internationalen Leihgeber*innen sowie aus der eigenen Sammlung zu sehen sein. Dabei stehen Themen wie das Zeitgeschehen, der Alltag der Menschen, die Industrialisierung, eine neue Mobilität, das Menschenbild und das Bild der Frau sowie Porträts, Stillleben und Landschaft im Mittelpunkt, welche diese Epoche als eine der Umbrüche und Kontraste charakterisieren.
Der Ausstellungsteil „Rückblick“ wird sich mit der Entstehungsgeschichte der Stilrichtung wie auch der Genese der Ausstellung und deren Protagonisten von 1925 befassen. Als zentrale Akteure stehen hier Franz Roh und Gustav Friedrich Hartlaub im Fokus. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf die 1925 in Mannheim gezeigten Gemälde gerichtet.
Der detaillierte Blick in die Ausstellung von 1925 erfolgt vor allem in digitaler Form, da viele der gezeigten Objekte heute entweder zerstört, nicht ausleihbar oder unauffindbar sind. Gleichzeitig wird eine Auswahl damals in Mannheim zu sehender Spitzenwerke aus den Beständen der Kunsthalle oder als Leihgaben anderer Museen Teil der Ausstellung sein und einen Querschnitt durch die historische Schau bieten.
Die Ausstellung von 1925 soll einer kritischen Revision unterzogen werden. So war in dieser Ausstellung von 1925 keine einzige Künstlerin vertreten, obwohl deren Schaffen in den 1910er- bis 1930er-Jahren ebenfalls als wesentlicher Beitrag zur neusachlichen Malerei gewertet werden muss. Allen voran Kate Diehn-Bitt, Lotte Laserstein, Jeanne Mammen und Anita Rée.
Ebenso würdigte Hartlaub 1925 noch nicht vollumfänglich die internationale Dimension der von ihm beschriebenen Kunstrichtung. So wird im Rahmen der geplanten Ausstellung eine Reihe von exemplarischen Werken als neusachlich zu begreifender Künstler*innen aus Italien, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und den USA gezeigt.
Hartlaub selbst hatte mit seiner Ausstellung „Deutsche Provinz (Erster Teil) Beschauliche Sachlichkeit“, sein letztes Ausstellungsvorhaben vor seiner Amtsenthebung durch die Nationalsozialisten im März 1933, bereits eine Art kritisches Update über die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Neuen Sachlichkeit gewagt. Auch wenn die Neue Sachlichkeit mit Beginn der 1930er-Jahre ihren Höhepunkt bereits überschritten und ihre avantgardistische Schlagkraft mehr und mehr verloren hatte, entsprangen ihr dennoch weiterhin innovative Ansätze.
Ziel des dritten Teils der Ausstellung ist es, die weitere Entwicklung der Richtung insbesondere innerhalb des deutschen Sprachraums während des Nationalsozialismus nachzuzeichnen und dabei auch das Schicksal einzelner Künstler*innen sichtbar zu machen.
Die 1920er-Jahre in Mannheim
Die Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim als Ausgangspunkt nehmend, finden zahlreiche Kooperationen mit wichtigen kulturellen Akteuren der Stadt Mannheim statt, die sich mit den 1920er-Jahren auseinandersetzen. Mit diesem Projekt zeigt Mannheim in der Saison 2024/25 sein vielfältiges Gesicht. Mit einem Motto „Die 1920er-Jahre in Mannheim“ wird dieses spartenübergreifende Kulturhighlight der Region und damit sämtliche Aktivitäten der beteiligten Partner unter einem Dach zusammengefasst. Die Dachmarke macht Mannheim als Reiseziel für Individual- und Gruppenreisende attraktiv und zeigt, dass die Stadt auch nach der BUGA 23 ein interessantes touristisches Ziel ist. Dabei sind unter anderem das Nationaltheater Mannheim, die Reiss-Engelhorn-Museen, das Technoseum, das MARCHIVUM, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim, das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, das Cinema Quadrat e.V., die Mannheimer Abendakademie sowie das Institut für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg, um nur einige zu nennen.

Ausgebucht: "Die Neue Sachlichkeit" Vorlesungsreihe der Universität Heidelberg, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Prof. Dr. Henry Keazor
Information zum Termin
Hinweis: Studierende, Gasthörer*innen und Hochschulangehörige, die sich bereits über die Uni HD angemeldet haben, nehmen kostenfrei an den Vorlesungen teil. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze ausgebucht sind.
2025 jährt sich die berühmte Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“, die der nach 1946 auch an der Universität Heidelberg Kunstgeschichte lehrende Gustav Friedrich Hartlaub vom 14. Juni bis 18. September 1925 als Direktor der Mannheimer Kunsthalle organisiert hatte. Dieses 100-jährige Jubiläum nimmt die Kunsthalle zum Anlass, um zwischen dem 22. November 2024 und dem 9. März 2025 mit „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ eine Ausstellung zu zeigen, mit der Hartlaubs legendäre Schau zum einen für ihre Leistungen gewürdigt wird: Mit sicherem Blick hatte er das Schaffen verschiedener Akteure verbindende Elemente gesehen und deren Werke unter einem Begriff zusammengefasst, der sodann einer ganzen Kunstströmung und schließlich auch einer literarischen Richtung der Literatur der Weimarer Republik ihren Namen geben sollte. In beiden Fällen wurde die Neue Sachlichkeit als eine Reaktion auf das Pathos des Expressionismus gesehen, auf das mit einer Hinwendung zur nüchternen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit reagiert wurde. Die 2024 eröffnende Mannheimer Ausstellung möchte sich jedoch zugleich auch kritisch mit Hartlaubs Konzeption von Neuer Sachlichkeit auseinandersetzen, bei der unter rund 130 gezeigten Gemälden (u.a. von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Heinrich Maria Davringhausen, Adolf Erbslöh, Ernst Fritsch, Nicolas Gluschenko, Ernst Haider, Wilhelm Heise, Karl Hubbuch, Alexander Kanoldt, Walter Schulz-Matan, Carlo Mense, Anton Räderscheidt, Rudolf Schlichter, Georg Schrimpf, Georg Scholz und Niklaus Stoecklin) zum Beispiel keine Werke von Künstlerinnen vertreten waren.
Die Vorlesung wird nicht nur parallel zu der Ausstellung stattfinden, sondern – ausnahmsweise – auch an der Mannheimer Kunsthalle selbst, was den Vorteil hat, in unmittelbarer Nachbarschaft der Ausstellung und der dort versammelten Werke gehalten werden zu können. Thematisiert werden dabei die Entstehungsumstände der als typisch für die Neue Sachlichkeit erachteten Kunst, deren Entwicklung sowie deren letztendliche Ausdifferenzierung in einen konservativen, einen veristisch-sozialkritisch ausgerichteten sowie einen dritten Flügel, der in Gestalt des Magischen Realismus die Brücke zum Surrealismus darstellte. Sie alle positionierten sich sodann auch hinsichtlich des Nationalsozialismus je sehr unterschiedlich. Die Vorlesung wird zuletzt auch der späteren künstlerischen Rezeption der Neuen Sachlichkeit sowie ihr verwandten Strömungen in anderen Ländern (z.B. in den USA in Gestalt von Künstlern wie Edward Hopper und Grant Wood) nachgehen.
Ort: Auditorium, Kunsthalle Mannheim

Ausgebucht: "Die Neue Sachlichkeit" Vorlesungsreihe der Universität Heidelberg, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Prof. Dr. Henry Keazor
Information zum Termin
Hinweis: Studierende, Gasthörer*innen und Hochschulangehörige, die sich bereits über die Uni HD angemeldet haben, nehmen kostenfrei an den Vorlesungen teil. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze ausgebucht sind.
2025 jährt sich die berühmte Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“, die der nach 1946 auch an der Universität Heidelberg Kunstgeschichte lehrende Gustav Friedrich Hartlaub vom 14. Juni bis 18. September 1925 als Direktor der Mannheimer Kunsthalle organisiert hatte. Dieses 100-jährige Jubiläum nimmt die Kunsthalle zum Anlass, um zwischen dem 22. November 2024 und dem 9. März 2025 mit „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ eine Ausstellung zu zeigen, mit der Hartlaubs legendäre Schau zum einen für ihre Leistungen gewürdigt wird: Mit sicherem Blick hatte er das Schaffen verschiedener Akteure verbindende Elemente gesehen und deren Werke unter einem Begriff zusammengefasst, der sodann einer ganzen Kunstströmung und schließlich auch einer literarischen Richtung der Literatur der Weimarer Republik ihren Namen geben sollte. In beiden Fällen wurde die Neue Sachlichkeit als eine Reaktion auf das Pathos des Expressionismus gesehen, auf das mit einer Hinwendung zur nüchternen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit reagiert wurde. Die 2024 eröffnende Mannheimer Ausstellung möchte sich jedoch zugleich auch kritisch mit Hartlaubs Konzeption von Neuer Sachlichkeit auseinandersetzen, bei der unter rund 130 gezeigten Gemälden (u.a. von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Heinrich Maria Davringhausen, Adolf Erbslöh, Ernst Fritsch, Nicolas Gluschenko, Ernst Haider, Wilhelm Heise, Karl Hubbuch, Alexander Kanoldt, Walter Schulz-Matan, Carlo Mense, Anton Räderscheidt, Rudolf Schlichter, Georg Schrimpf, Georg Scholz und Niklaus Stoecklin) zum Beispiel keine Werke von Künstlerinnen vertreten waren.
Die Vorlesung wird nicht nur parallel zu der Ausstellung stattfinden, sondern – ausnahmsweise – auch an der Mannheimer Kunsthalle selbst, was den Vorteil hat, in unmittelbarer Nachbarschaft der Ausstellung und der dort versammelten Werke gehalten werden zu können. Thematisiert werden dabei die Entstehungsumstände der als typisch für die Neue Sachlichkeit erachteten Kunst, deren Entwicklung sowie deren letztendliche Ausdifferenzierung in einen konservativen, einen veristisch-sozialkritisch ausgerichteten sowie einen dritten Flügel, der in Gestalt des Magischen Realismus die Brücke zum Surrealismus darstellte. Sie alle positionierten sich sodann auch hinsichtlich des Nationalsozialismus je sehr unterschiedlich. Die Vorlesung wird zuletzt auch der späteren künstlerischen Rezeption der Neuen Sachlichkeit sowie ihr verwandten Strömungen in anderen Ländern (z.B. in den USA in Gestalt von Künstlern wie Edward Hopper und Grant Wood) nachgehen.
Ort: Auditorium, Kunsthalle Mannheim

Ausgebucht: "Die Neue Sachlichkeit" Vorlesungsreihe der Universität Heidelberg, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Prof. Dr. Henry Keazor
Information zum Termin
Hinweis: Studierende, Gasthörer*innen und Hochschulangehörige, die sich bereits über die Uni HD angemeldet haben, nehmen kostenfrei an den Vorlesungen teil. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze ausgebucht sind.
2025 jährt sich die berühmte Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“, die der nach 1946 auch an der Universität Heidelberg Kunstgeschichte lehrende Gustav Friedrich Hartlaub vom 14. Juni bis 18. September 1925 als Direktor der Mannheimer Kunsthalle organisiert hatte. Dieses 100-jährige Jubiläum nimmt die Kunsthalle zum Anlass, um zwischen dem 22. November 2024 und dem 9. März 2025 mit „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ eine Ausstellung zu zeigen, mit der Hartlaubs legendäre Schau zum einen für ihre Leistungen gewürdigt wird: Mit sicherem Blick hatte er das Schaffen verschiedener Akteure verbindende Elemente gesehen und deren Werke unter einem Begriff zusammengefasst, der sodann einer ganzen Kunstströmung und schließlich auch einer literarischen Richtung der Literatur der Weimarer Republik ihren Namen geben sollte. In beiden Fällen wurde die Neue Sachlichkeit als eine Reaktion auf das Pathos des Expressionismus gesehen, auf das mit einer Hinwendung zur nüchternen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit reagiert wurde. Die 2024 eröffnende Mannheimer Ausstellung möchte sich jedoch zugleich auch kritisch mit Hartlaubs Konzeption von Neuer Sachlichkeit auseinandersetzen, bei der unter rund 130 gezeigten Gemälden (u.a. von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Heinrich Maria Davringhausen, Adolf Erbslöh, Ernst Fritsch, Nicolas Gluschenko, Ernst Haider, Wilhelm Heise, Karl Hubbuch, Alexander Kanoldt, Walter Schulz-Matan, Carlo Mense, Anton Räderscheidt, Rudolf Schlichter, Georg Schrimpf, Georg Scholz und Niklaus Stoecklin) zum Beispiel keine Werke von Künstlerinnen vertreten waren.
Die Vorlesung wird nicht nur parallel zu der Ausstellung stattfinden, sondern – ausnahmsweise – auch an der Mannheimer Kunsthalle selbst, was den Vorteil hat, in unmittelbarer Nachbarschaft der Ausstellung und der dort versammelten Werke gehalten werden zu können. Thematisiert werden dabei die Entstehungsumstände der als typisch für die Neue Sachlichkeit erachteten Kunst, deren Entwicklung sowie deren letztendliche Ausdifferenzierung in einen konservativen, einen veristisch-sozialkritisch ausgerichteten sowie einen dritten Flügel, der in Gestalt des Magischen Realismus die Brücke zum Surrealismus darstellte. Sie alle positionierten sich sodann auch hinsichtlich des Nationalsozialismus je sehr unterschiedlich. Die Vorlesung wird zuletzt auch der späteren künstlerischen Rezeption der Neuen Sachlichkeit sowie ihr verwandten Strömungen in anderen Ländern (z.B. in den USA in Gestalt von Künstlern wie Edward Hopper und Grant Wood) nachgehen.
Ort: Auditorium, Kunsthalle Mannheim

Ausgebucht: "Die Neue Sachlichkeit" Vorlesungsreihe der Universität Heidelberg, Institut für Europäische Kunstgeschichte, Prof. Dr. Henry Keazor
Information zum Termin
Hinweis: Studierende, Gasthörer*innen und Hochschulangehörige, die sich bereits über die Uni HD angemeldet haben, nehmen kostenfrei an den Vorlesungen teil. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze ausgebucht sind.
2025 jährt sich die berühmte Ausstellung „Die Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus“, die der nach 1946 auch an der Universität Heidelberg Kunstgeschichte lehrende Gustav Friedrich Hartlaub vom 14. Juni bis 18. September 1925 als Direktor der Mannheimer Kunsthalle organisiert hatte. Dieses 100-jährige Jubiläum nimmt die Kunsthalle zum Anlass, um zwischen dem 22. November 2024 und dem 9. März 2025 mit „Die Neue Sachlichkeit – Ein Jahrhundertjubiläum“ eine Ausstellung zu zeigen, mit der Hartlaubs legendäre Schau zum einen für ihre Leistungen gewürdigt wird: Mit sicherem Blick hatte er das Schaffen verschiedener Akteure verbindende Elemente gesehen und deren Werke unter einem Begriff zusammengefasst, der sodann einer ganzen Kunstströmung und schließlich auch einer literarischen Richtung der Literatur der Weimarer Republik ihren Namen geben sollte. In beiden Fällen wurde die Neue Sachlichkeit als eine Reaktion auf das Pathos des Expressionismus gesehen, auf das mit einer Hinwendung zur nüchternen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit reagiert wurde. Die 2024 eröffnende Mannheimer Ausstellung möchte sich jedoch zugleich auch kritisch mit Hartlaubs Konzeption von Neuer Sachlichkeit auseinandersetzen, bei der unter rund 130 gezeigten Gemälden (u.a. von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz, Heinrich Maria Davringhausen, Adolf Erbslöh, Ernst Fritsch, Nicolas Gluschenko, Ernst Haider, Wilhelm Heise, Karl Hubbuch, Alexander Kanoldt, Walter Schulz-Matan, Carlo Mense, Anton Räderscheidt, Rudolf Schlichter, Georg Schrimpf, Georg Scholz und Niklaus Stoecklin) zum Beispiel keine Werke von Künstlerinnen vertreten waren.
Die Vorlesung wird nicht nur parallel zu der Ausstellung stattfinden, sondern – ausnahmsweise – auch an der Mannheimer Kunsthalle selbst, was den Vorteil hat, in unmittelbarer Nachbarschaft der Ausstellung und der dort versammelten Werke gehalten werden zu können. Thematisiert werden dabei die Entstehungsumstände der als typisch für die Neue Sachlichkeit erachteten Kunst, deren Entwicklung sowie deren letztendliche Ausdifferenzierung in einen konservativen, einen veristisch-sozialkritisch ausgerichteten sowie einen dritten Flügel, der in Gestalt des Magischen Realismus die Brücke zum Surrealismus darstellte. Sie alle positionierten sich sodann auch hinsichtlich des Nationalsozialismus je sehr unterschiedlich. Die Vorlesung wird zuletzt auch der späteren künstlerischen Rezeption der Neuen Sachlichkeit sowie ihr verwandten Strömungen in anderen Ländern (z.B. in den USA in Gestalt von Künstlern wie Edward Hopper und Grant Wood) nachgehen.
Ort: Auditorium, Kunsthalle Mannheim

Überblicksführung "Die Neue Sachlichkeit"
Information zum Termin
Eine ganze Epoche mit einem einzelnen Begriff zu prägen, gelingt nur äußerst selten. Dem jungen Mannheimer Kunsthallen-Direktor Gustav F. Hartlaub ist mit seiner legendären Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ 1925 jedoch genau das geglückt. Weit über seine kunsthistorische Bedeutung hinaus, ist der Begriff zum Synonym für den kulturellen Aufbruch der 1920er-Jahre geworden – und für die in Kunst, Architektur und Literatur zu beobachtende Rationalität und sachliche Präzision, die als Reaktion auf die großen politischen und sozialen Umwälzungen dieses Jahrzehnts gelten kann. Hundert Jahre später widmet die Kunsthalle Mannheim dem Phänomen „Neue Sachlichkeit“ eine große Ausstellung, die sowohl die damalige Leistung würdigt, sie aber auch kritisch hinterfragt und ergänzt, vor allem um das Schaffen von Künstlerinnen, war doch in der Ausstellung von 1925 keine einzige Frau vertreten.